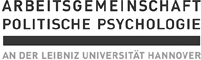„Im Gleichschritt zur Diktatur“
»HARZBURGER FRONT« VON 1931 und »RECHTSEXTREMISMUS HEUTE«
Doppelausstellung und Vortragsreihe vom 7. – 25. März
Volkshochschule Hannover
Theodor-Lessing-Platz 1
Unter dem Begriff »Harzburger Front« ging 1931 das angestrebte
Bündnis deutschnationaler Kräfte mit den Nationalsozialisten
zur Zerschlagung der Demokratie in die Geschichte ein. Die Ausstellung
erläutert, warum die »nationale Front« gerade Bad
Harzburg für ihr Treffen wählte, welche Begeisterung das Bürgertum
vor Ort zeigte, wie und warum die »Harzburger Front«
den Siegeszug des Nationalsozialismus beförderte.
Die ergänzende Ausstellung zum Rechtsextremismus heute gibt
einen Einblick in die Propagandastrategien der Rechten und in
ihr Weltbild. Die Ungleichwertigkeit der Menschen, Vorrechte für
Deutsche, Gewaltakzeptanz und die Instrumentalisierung sozialer
Themen prägen das Auftreten und ihre Agitation.
Durch die Verbindung der beiden Ausstellungen sowie durch die
Vortragsreihe können Kontinuitäten rechtsextremen Denkens verdeutlich werden.
Hier gehts zum Flyer mit näheren und weiteren Infos zur Veranstaltung.
Jour fixe im Februar
Mi,09.02.2011, 18 Uhr c.t.
Im Moore 21, Vorderhaus, Raum A210
Symbol und Nationalisierung der Gesellschaft.
Die Erfindung der Türkei
Vortrag von und Diskussion mit Mihri Özdogan
Nach dem Ersten Weltkrieg verfolgte die kemalistische Elite in der neu gegründeten Republik Türkei mit ihrer systematischen und zum Teil auch gewaltsam betriebenen Kulturpolitik das Ziel eine Nation aufzubauen. Diesen Prozess wird Mihri Oezdogan in seinem Vortrag sozialpsychologisch analysieren. Hierbei stellt sich die Frage, was eine Nation ist: Die nationale Imagination lässt sich nicht auf ihren lediglich kognitiven Gehalt reduzieren. Sie ist also nicht nur als ein über das Medium der Sprache aufgebautes ideologisches Konstrukt aufzufassen, sondern wird vor allem mittels kultureller Symbole präsentativer Art konstituiert. Alfred Lorenzers symboltheoretisches Modell zur Entstehung kollektiver Identitäten, das sich an den Erkenntnissen der Psychoanalyse orientiert, hilft zu erklären, warum die nationale Imagination als ein bildhaftes, traumähnliches Konstrukt zu begreifen ist und wie die Einzelnen mittels kultureller Symbole emotional an die Nation gebunden werden. Die darauf aufbauende sozialpsychologische Analyse der kemalistischen Kulturpolitik soll am Beispiel der Türkei zeigen, wie dort eine über symbolische Praktiken erfolgende Nationalisierung der Gesellschaft vorangetrieben wurde.
Plakat zum Jour fixe
Jour Fixe im Januar
Mi, 12.1.2010, 18 Uhr
Im Moore 21, Vorderhaus, Raum A210
Filmvorführung:
Fight Club
Regie: David Fincher, USA 1999
Der Film schildert den „Ausbruch“ des Protagonisten aus der von ihm als „verweiblichend“ und entfremdend wahrgenommenen Konsumwelt durch die Gründung von männerbündischen „Fight Clubs“: „Nirgendwo fühlt man sich so lebendig wie hier.“ Besteht der Zweck dieser Clubs anfänglich in ritualisierten, blutigen Schlägereien unter den Mitgliedern, so wandelt sich dies im Laufe des Films: Die „Fight Clubs“ entwickeln sich zu einer paramilitärischen Organisation, die versucht u.a. durch Bombenanschläge auf Banken die gesellschaftliche Ordnung zu erschüttern. Im Mittelpunkt von „Fight Club“ steht die „Krise der Männlichkeit“ und Gewalt als ein Versuch, diese Männlichkeit zu restituieren.
Der Film ist sehr kontrovers diskutiert worden. Slavoj Zizek etwa sieht in der dargestellten Gewalt ein revolutionäres Potential: „Although this strategy is risky and ambiguous (it can easily regress into a proto-fascist macho logic of violent male bonding), this risk has to be taken – there is no other direct way out of the closure of capitalist subjectivity”. Aber auch die neurechte „Junge Freiheit” hat „Fight Club” positiv besprochen.
In dem Jour Fixe wird der Film gezeigt und anschließend diskutiert.
Plakat zum Jour Fixe
Jour fixe im Dezember
Mi, 08.12.2010, 18 Uhr
Im Moore 21, Vorderhaus, Raum A210
Jan Lohl:
Gefühlserbschaft und Rechtsextremismus
Generationenübergreifende Folgewirkungen des Nationalsozialismus in Familien von NS-VolksgenossInnen wurden bisher nur lückenhaft untersucht. Jan Lohl schließt diese Lücken in seiner jüngst erschienenen Untersuchung »Ge-fühlserbschaft und Rechtsextremismus. Eine sozialpsychologische Studie zur Generationengeschichte des Nationalsozialismus«. Auf dem Jour Fixe wird er die Hauptthesen seiner Arbeit skizzieren und zur Diskussion stellen.
Die Studie untersucht die intergenerationellen Folgen des Nationalsozialismus in den Familien von NS-Volksgenossen und ihre politische Handlungsrelevanz: Ausgehend von der »Unfähigkeit zu trauern« (Alexander & Margarete Mitscherlich), werden die nonlinearen Spuren einer affektiven Integration in die NS-Volksgemeinschaft über drei Generationen hinweg systematisch nachgezeichnet. Neu ist die Erkenntnis, wie der nationalsozialistische kollektiven Narzissmus tradiert wird und welche Mechanismen hierbei wirksam werden. Auf dieser Basis gelingt der Nachweis, dass NS-Gefühlserbschaften noch in der Enkelgeneration eine Andockstelle für jene paranoiden Ideologien darstellen, die in rechtsextremen Gruppen vermittelt werden. Das intergenerationelle Verhältnis von aktuellem Rechtsextremismus und Nationalsozialismus ist sozialpsychologisch zu analysieren; eine solche Analyse zeigt, dass die Entwicklung nationalistischer und antisemitischer Handlungsmuster aus einer intergenerationelle Perspektive verstanden werden muss.
Es besteht nach dem Jour Fixe die Möglichkeit das Buch zum vergünstigten Autorenpreis zu erwerben (20 statt 50 Euro).
Jour fixe im November
Mi, 10.11.2010, 18 Uhr
Im Moore 21, Vorderhaus, Raum A210
„Was bleibt“
Filmvorführung mit anschließender Diskussion
Im November zeigt die AG PolPsy den Film „Was bleibt“ von den Regisseurinnen Gesa Knolle und Birthe Templin, die ihren Film so beschreiben:
‚Was bleibt’ ist der erste Dokumentarfilm, der die familieninterne Aus-einandersetzung mit dem Holocaust sowohl auf der Seite der Täter, sowie der Opfer beleuchtet. Der Film lässt Frauen zu Wort kommen, die auf sehr unterschiedliche Weise mit der deutschen Vergangenheit und ihrer Gegenwart verbunden sind. So wird zum einen über eine Frau be-richtet, die mit ihrer Mutter auf Transport nach Auschwitz geht, in der Hoffnung, sie schützen zu können. Als sie nach Ravensbrück überstellt wird, sieht sie ihre Mutter zum letzten Mal und gibt ihr das Versprechen, von dem erlebten Grauen zu erzählen. Das tut sie bis heute in Schulen und anderen Orten. Sowohl ihre Tochter wie ihre Enkelin sehen es als Familienaufgabe, die Geschichte weiter zu tragen. Zum anderen erzählt ‚Was bleibt’ von einer Frau, die erst als Jugendliche erfährt, dass sie nicht von ihrer leiblichen Mutter, sondern ihrer Tante aufgezogen wurde. Nachforschungen zeigen, dass ihre Mutter KZ-Aufseherin war. Bis heute versucht sie herauszufinden, was für ein Mensch ihre Mutter gewesen ist und kann damit nicht aufhören, obwohl sie weiß, dass der Schmerz schlimmer wird, je mehr sie sich damit beschäftigt. Vielleicht auch deswegen ist ihre Tochter distanziert gegenüber ihrer Familiengeschichte und lässt nur manchmal die Angst zu, eine intergenerationelle Vorbelastung, eine brutale Härte zu haben.
Plakat zum Jour Fixe