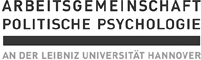Jour fixe im Juni
Mi,08.06.2011, 18 Uhr c.t.
Im Moore 21, Vorderhaus, Raum A210
Daniela Celleri:
Indigene Jugendliche.
Ethnizität, Klasse und Geschlecht am Beispiel der Kichwa-Otavalos im Hochland Ecuadors
In den letzten Jahren wird zunehmend auf die Verschränkung von Differenzkategorien wie Alter, Ethnizität, Klasse und Geschlecht bei der Analyse von sozialen Ungleichheiten hingewiesen. Für die sozialen Verhältnisse in einem Land wie Ecuador ist diese Diskussion besonders relevant: Ecuador verzeichnet einen der höchsten indigenen Bevölkerungsanteile der Staaten Latein-amerikas und eine hohe Anzahl an sehr jungen Menschen. Durch zunehmende Urbanisierungsprozesse veränderte sich in den letzten fünfzig Jahren die Sozialstruktur der untersuchten Region „Otavalos“ tiefgehend: Ethnisierungsprozesse weiten sich aus und verleihen sozialen Status an ökonomisch etablierte indigene Familien. In diesem Kontext verändern sich auch die Konflikte um das Geschlechter- und Generationenverhältnis.
Anhand entsprechenden Bildmaterials aus einer 5-monatigen ethnologischen Feldforschung sollen die Widersprüche und Wechselseitigkeiten dieser Ungleichheitskategorien diskutiert werden.
Plakat zum Jour fixe
Jour fixe im Mai
Mi,11.05.2011, 18 Uhr c.t.
Im Moore 21, Vorderhaus, Raum A210
Hans-Jürgen Wirth:
Von Hiroshima über Tschernobyl bis Fukushima
Was bedeutet die »kriegerische«, was die »friedliche« Nutzung der Atomkraft für unsere seelische Befindlichkeit?
Der Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki bildet eine historische Zäsur, die sozialpsychologisch als kollektives Trauma der »Gattungs-Identität« (Lifton) verstanden werden kann. Die »friedliche Nutzung der Atomkraft« diente als »Integrationsideologie der fünfziger Jahre« (Radkau) und untermauerte die weltweite Verleugnung der atomaren Gefahr. Die Jugend- und Protestbewegungen der 60er und 70er Jahre formulierten erstmals eine Fundamentalkritik sowohl der friedlichen als auch der kriegerischen Nutzung der Atomkraft. Diese wachstumskritischen Initiativen waren in Westdeutschland besonders heftig, einflussreich und nachhaltig, weil hier die expansionskritischen Bewegungen zusätzliche Impulse aus der Konfrontation mit dem Nationalsozialismus und dem »Zivilisationsbruch« des Holocaust erhielten.
Diese psychohistorischen Prozesse werden unter sozialpsychoana-lytischen Gesichtspunkten dargestellt und diskutiert.
Plakat zum Jour fixe
Jour fixe im April
Mi,13.04.2011, 18 Uhr c.t.
Im Moore 21, Vorderhaus, Raum A210
Oliver Decker:
Zur Sozialpsychologie des Rechtsextremismus.
Welche Gegenwart hat die Vergangenheit?
In den bevölkerungsrepräsentativen Untersuchungen zur rechtsextremen Einstellung zeigt sich über die Jahre eine relativ geringe Zustimmung zur Verherrlichung des Nationalsozialismus. Es scheint, als würde der Nationalsozialismus gegenüber anderen Themen der Rechten in der Bevölkerung keine große Rolle mehr spielen. Erst bei genauerem Hinsehen zeigt sich die Gegenwart der Vergangenheit.
In diesem Vortrag werden die Ergebnisse einer Gruppendiskussionsstudie vorgestellt, welche auf die Bedeutung des Angriffs- und Vernichtungskriegs für nicht-jüdische Deutsche über die Generationen hinweg hinweisen. Die „Unfähigkeit zu trauern“ (Alexander Mitscherlich / Margarete Mitscherlich) hat über die Generationen hinweg ihre Spuren hinterlassen.
Plakat zum Jour fixe
„Volksgemeinschaft, Täterschaft und Antisemitismus“
Eben erschienen:
Markus Brunner, Jan Lohl, Rolf Pohl, Sebastian Winter (Hg.):
Volksgemeinschaft, Täterschaft und Antisemitismus.
Beiträge zur psychoanalytischen Sozialpsychologie des Nationalsozialismus und seiner Nachwirkungen
Was machte die Idee der Volksgemeinschaft und den Antisemitismus für die Menschen im Nationalsozialismus so attraktiv? Wie wurden sie zu Tätern und Täterinnen? Wie wirken sich NS-Gefühlserbschaften noch in den nachfolgenden Generationen aus? Der Nationalsozialismus und seine gesellschaftlichen Nachwirkungen sind ohne eine sozialpsychologische Perspektive nicht zu verstehen. Dies erfordert die Berücksichtigung der subjektiven Dimension der Nachkriegsgesellschaft sowie der Brüche und Kontinuitäten nach 1945.
Der Band versammelt Aufsätze, die sich aus einer psychoanalytisch-sozialpsychologischen und geschlechtertheoretischen Perspektive sowohl mit den psychodynamischen Mechanismen der nationalsozialistischen Weltanschauung und Gewalt als auch mit den Versuchen ihrer psychischen Verarbeitung in der Nachkriegszeit auseinandersetzen.
Mit Beiträgen von Markus Brunner, Isabelle Hannemann, Sascha Howind, Jan Lohl, Rolf Pohl, Wolfram Stender und Sebastian Winter
http://web.psychosozial-verlag.de/psychosozial/details.php?p_id=2055
Jour fixe im Februar
Mi,09.02.2011, 18 Uhr c.t.
Im Moore 21, Vorderhaus, Raum A210
Symbol und Nationalisierung der Gesellschaft.
Die Erfindung der Türkei
Vortrag von und Diskussion mit Mihri Özdogan
Nach dem Ersten Weltkrieg verfolgte die kemalistische Elite in der neu gegründeten Republik Türkei mit ihrer systematischen und zum Teil auch gewaltsam betriebenen Kulturpolitik das Ziel eine Nation aufzubauen. Diesen Prozess wird Mihri Oezdogan in seinem Vortrag sozialpsychologisch analysieren. Hierbei stellt sich die Frage, was eine Nation ist: Die nationale Imagination lässt sich nicht auf ihren lediglich kognitiven Gehalt reduzieren. Sie ist also nicht nur als ein über das Medium der Sprache aufgebautes ideologisches Konstrukt aufzufassen, sondern wird vor allem mittels kultureller Symbole präsentativer Art konstituiert. Alfred Lorenzers symboltheoretisches Modell zur Entstehung kollektiver Identitäten, das sich an den Erkenntnissen der Psychoanalyse orientiert, hilft zu erklären, warum die nationale Imagination als ein bildhaftes, traumähnliches Konstrukt zu begreifen ist und wie die Einzelnen mittels kultureller Symbole emotional an die Nation gebunden werden. Die darauf aufbauende sozialpsychologische Analyse der kemalistischen Kulturpolitik soll am Beispiel der Türkei zeigen, wie dort eine über symbolische Praktiken erfolgende Nationalisierung der Gesellschaft vorangetrieben wurde.
Plakat zum Jour fixe