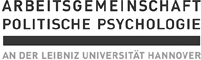Unheimliche Wiedergänger? Zur politischen Psychologie des NS-Erbes in der 68er Generation
Vortrag von Dr. Jan Lohl am 8. November
Häufig wird als Leistung der ›68er‹ hervorgehoben, dass sie die Generation ihrer Eltern und die (west-)deutsche Nachkriegskultur aufgrund deren Verstrickung in den Nationalsozialis-mus angeklagt und damit eine Demokratisierung sowie eine Aufarbeitung der Vergangenheit gefördert haben. Ganz im Gegenteil zu dieser Annahme wurden die ›68er‹ in den 60er Jah-ren von den Massenmedien, an den Stamm- und Familientischen mit den Nazis verglichen. Der These, dass die ›68er‹ unheimliche Wiedergänger der Nationalsozialisten waren, hat der Historiker Götz Aly 2008 neue Kraft verliehen: Antisemitismus, Gewaltbereitschaft, Aktionis-mus und eine Behinderung der Vergangenheitsaufarbeitung seien schwere Fehler der ›68er‹ gewesen. Diese Fehler sind nach Aly ganz einfach damit zu erklären, dass die ›68er‹ eben die Kinder der Nationalsozialisten waren.
Der Vortrag von Jan Lohl differenziert diese These kritisch und fragt nach den intergeneratio-nellen Beziehungen zwischen der ›68er‹-Generation und ihren Eltern aus einem historischen und sozialpsychologischen Blickwinkel: Welches unheimlich Vertraute stellen die ›68er‹ ei-gentlich für ihre Eltern dar? Was haben diese Eltern an ihren rebellischen Kindern unbewusst wahrgenommen? Was hat diese Wahrnehmung mit den Kindern gemacht? Und: Haben die Kinder diese elterlichen Wahrnehmung ihrer Person verinnerlicht und in ihrem politischen Handeln ausgedrückt – falls ja, wie?
Ort: VHS Hannover, Theodor-Lessing-Platz 1
Zeit: 8.11., 18:30 – 20:30
Jour fixe im November
Mi,09.11.2011, 18 Uhr c.t.
Im Moore 21, Vorderhaus, Raum A210
Anke Prochnau (Frankfurt a.M.):
Ebenso notwendig wie schwierig: Thematisierung von Männlichkeit
Mit den soziologischen Konzepten der hegemonialen Männlichkeit (Connell) und der männlichen Herrschaft (Bourdieu) ist zunehmend die soziale Konstruktion von ‚Männlichkeit‘ Gegenstand der Geschlechterforschung geworden. Das in vielen gesellschaftlichen Bereichen (noch) vorherrschende Leitbild von ‚Männlichkeit‘ ist an die eindeutige Herstellung von heteronormativer und hierarchisierter Zweigeschlechtlichkeit sowie an dichotome und stereotype Geschlechterrollen gebunden. Mittlerweile gibt es eine sich etablierende kritische Männer- und Männlichkeitsforschung, die Beharrungstendenzen von ‚Männlichkeit(en)‘, aber auch deren Veränderungsbedingungen in den Blick nehmen und ein differenzierte(re)s Bild der Geschlechterverhältnisse verhandelt. Anhand von Beispielen aus der politischen Bildung wird der Vortrag erläutern, wie die Konstruktion von ‚Männlichkeit(en)‘ und die Schwierigkeit, diese zu thematisieren zusammen hängen.
Dabei soll der Anspruch an kritische, subjektorientierte politische Bildung deutlich werden, welcher nicht die Erweiterung der Thematisierung von struktureller geschlechtsspezifischer Benachteiligung um die Perspektive struktureller geschlechtsspezifischer Privilegierung sein kann. Um die geschlechterübergreifende Konstruktion und Einsozialisierung einer vergeschlechtlichten Machtordnung sowie die darin enthaltenen Brüche, Diskontinuitäten und Kontingenzen von Geschlechtsidentität für die Themen der politischen Bildung in den Blick bekommen zu können, müssen integrative, geschlechterreflektierende Konzepte und identitätskritische (nicht-identitäre) Ansätze berücksichtigen werden. Damit kann die Rekonstruktion kollektiver Deutungsmuster, gesellschaftspolitischer Diskurse und Normen ermöglicht werden, die sich in den Subjekttheorien und damit auch in sozialer wie politischer Praxis niederschlagen. Daran sind auch sozialpsychologische Konzepte von Geschlecht(sidentität) und ‚Männlichkeit‘ zu messen.
Plakat zum Jour fixe
Tagung „Politische Psychologie – feministische Kritik“
Sa, 15.10.2011, 12-18 Uhr
Uni-Hauptgebäude, Welfengarten 1, Raum F342
Politische Psychologie – feministische Kritik
In den meisten klassischen Ansätzen der Politischen Psychologie bleibt „Geschlecht“ sowohl als gesellschaftliche Strukturkategorie unreflektiert als auch in seiner zentralen Bedeutung für die Subjektentwicklung ausgeblendet. Gleichzeitig werden oftmals implizit Gender-Vorstellungen vertreten, die als Tradierung von Geschlechterklischees zu problematisieren sind. Zudem drängt sich der Eindruck auf, die Politische Psychologie sei eine Männerdomäne, in der Beiträge von Frauen marginalisiert oder ignoriert werden. Eine grundsätzliche kritische Auseinandersetzung mit den Geschlechterentwürfen in der Politischen Psychologie ist daher dringend notwendig.
Parallel zur Entwicklung der Politischen Psychologie ab den 1970er Jahren hat sich im Kontext der feministischen Bewegung eine kritische Geschlechter(verhältnis)forschung entwickelt, die auch psychoanalytische und/oder sozialpsychologische Perspektive eingenommen hat. Diese setzt sich nicht nur kritisch mit bestehenden psychoanalytischen Konzepten der Konstitution von Geschlechtsidentität auseinander und entwickelt diese weiter, sondern thematisiert Geschlechterverhältnisse systematisch als zentralen Aspekt gesellschaftlicher Verhältnisse. Diese Linie gilt es für eine Weiterentwicklung der Politischen Psychologie aufzugreifen, soll diese nicht hinter dem Diskussionsstand der Geschlechterforschung zurückbleiben und damit einer defizitären Perspektive auf Gesellschaft aufsitzen. Eine feministische Kritik der Politischen Psychologie verweist damit weiterführend auf die Möglichkeit und die Notwendigkeit, unterschiedlich gelagerte Ungleichheits- und Gewaltverhältnisse politisch-psychologisch genauer zu analysieren.
Unsere kleine Tagung soll diese Problematik reflektieren. In drei Vorträgen und den anschließenden Diskussionen soll den impliziten Vorstellungen und Ausblendungen von Geschlecht in politisch-psychologischen Ansätzen, aber auch möglichen Anschlussstellen innerhalb der Politischen Psychologie für aktuelle feministische Debatten nachgegangen werden.
Programm:
12.00 Uhr: Einführung/Begrüßung
12.15-13.45 Uhr:
Julia König: Abstraktion und Blindheit. Geschlechtstheoretische Implikationen in Alfred Lorenzers Sozialisationstheorie que(e)r gelesen
– Diskussion –
13.45-15.15 Uhr:
Regina Becker-Schmidt: Politisch-psychologische Gedanken zu asymmetrischen Tauschverhältnissen aus feministischer Sicht
– Diskussion –
15.30-17.00 Uhr:
Sebastian Winter: „Ich liebe deutsche Land“. Eine Interpretation von „Lena“ als Nationalsymbol des „Partypatriotismus“ aus politisch-psychologischer und geschlechterkritischer Perspektive
– Diskussion –
17.00-18.00 Uhr: Abschlussdiskussion
Eintritt frei
Plakat zur Tagung
Jour Fixe im September
Mi,14.09.2011, 18 Uhr c.t.
Im Moore 21, Vorderhaus, Raum A210
Maria Tsenekidou (Hannover):
Geschichte und Lagebewusstsein
„Und wenn einige ältere Perspektiven untergegangen sind, müssen wir aufs Neue versuchen, zu begreifen und zu verändern; für beides scheinen mir unsere Geschichte und unser Bewusstsein das Arbeitsfeld. […] Was wir suchen, sind Einsichten über einen möglichen Zusammenhang individueller Geschichte, der Geschichte der eigenen Gesellschaft und der immanenten Problemgeschichte der Wissenschaft, die man lehrt und studiert – die Genesis der Probleme mit einbeziehend, an denen sie sich abmüht.“ (Peter Brückner)
Im Vortrag werden zentrale lebens- und gesellschaftsgeschichtliche Zusammenhänge des politischen Wissenschaftsverständnisses Peter Brückners beleuchtet. Der kritische und emanzipatorische Gehalt, sowie Problematiken dieses Ansatzes des Begründers der hannoverschen Politischen Psychologie werden hinsichtlich gegenwärtiger Anknüpfungsmöglichkeiten und -Schranken zur Diskussion gestellt.
Aufgeworfen wird auch die Frage nach der historischen Genesis der existenziellen Probleme, an denen sich Politische Psychologie in der Gegenwart abmüht, ebenso die Frage nach dem Verbleib des politisch-psychologischen Grundmotivs der (Selbst)Aufklärung und (Selbst)Befreiung.
Inwiefern könnte Lagebewusstsein zum Umgang mit untergegangenen und zur Eröffnung neuer Perspektiven unter veränderten Bedingungen verhelfen? Welche Herausforderungen könnten damit verbunden sein? Und was überhaupt könnte Lagebewusstsein heißen?
Plakat zum Jour fixe
Jour fixe im Juli
Mi,13.07.2011, 18 Uhr c.t.
Im Moore 21, Vorderhaus, Raum A210
Eva-Maria Ziege (Cambridge/Berlin):
Adorno und The Authoritarian Personality
Mit zwei Publikationen − Dialektik der Aufklärung (1944/47) und The Authoritarian Personality (1950) − wurde das Institut für Sozialforschung als Frankfurter Schule weltberühmt. Trotz vieler Unterschiede innerhalb seines inneren Kreises war diesem die Orientierung an der Kritik der politischen Ökonomie von Marx gemeinsam; hier kann man von einer verschwiegenen Orthodoxie sprechen. „Kritische Theorie“ wurde zu einem den Marxismus verdeckenden Euphemismus für Gesellschaftswissenschaft, die die Gesellschaft verändern will.
Alle Angehörigen dieses Arbeitszusammenhangs waren zudem mehr oder weniger von Freuds Psychoanalyse beeinflusst, mit der sie den Begriff des Unbewußten in die Analyse von Individuum und Gesellschaft einführten und mit dem Begriff der Libido die Sexualität als Motor dynamischer Prozesse von der Individualpsychologie in die Gesellschaftsanalyse transferierten. Den sogenannten „Sozial“- oder „Gesellschaftscharakter“ des Individuums begriff man als Ausdruck seiner Klassenlage, die jeweilige Ausbildung der Libido als Kitt der Gesellschaft, die die gesellschaftlichen Antagonismen überbrückte.
Dieser Konsens und die institutionellen Kontinuitäten mit Max Horkheimer als dem Direktor und Theodor W. Adorno als prominentem Exponenten des Instituts nach der Remigration 1950 verstellt den Blick auf Diskontinuitäten im Kreis der Mitarbeiter von den späten 20er bis in die 60er Jahre. Diese Diskontinuitäten aber sind ein Schlüssel zu komplexen Veränderungen in der auf Freud beruhenden Gesellschaftsanalyse; am wichtigsten hierfür war die Ablösung von Erich Fromm durch Adorno Ende der 30er Jahre.
Der Vortrag beschäftigt sich mit der Frage, welche Konsequenzen dies für den gesellschaftstheoretischen Kern der Kritischen Theorie und die Antisemitismustheorie des Instituts hatte.
Plakat zum Jour fixe