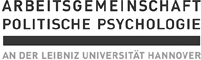School Shootings – Sinnlose Gewalt?
Dienstag, 20. November, 18:30 – 20:30 Uhr
VHS Hannover, Theodor-Lessing-Platz 1, 30159 Hannover
Sebastian Winter (Hannover):
Sinnlose Gewalt? Zur Selbstinszenierung von School Shootern als Rächer der Ausgegrenzten
Meldungen über Amokläufe von Schülern an ihren Schulen, sogenannte „School Shootings“, erschüttern regelmäßig die Öffentlichkeit. Die Motive der fast ausschließlich männlichen Täter erscheinen unbegreifbar. Häufig wird die Meinung vertreten, School Shooter seien einfach psychisch gestört und von einem übermäßigen Konsum gewalthaltiger Computerspiele geprägt.
Verschiedene Studien haben jedoch ergeben, dass sich bei School Shootern meist keine schwerwiegenden psychischen Erkrankungen feststellen lassen. Zwar sind einige Auffälligkeiten zu beobachten, die aber durchaus im Bereich des „Normalen“ liegen. Weiterführend ist dagegen die Suche nach dem subjektiven Sinn, den die Täter ihren Taten beilegen. Anhand von Tagebuchaufzeichnungen und ähnlichen Materialien lässt sich zeigen, dass sie sich selbst als heldenhafte Rächer der schulischen Außenseiter und Gemobbten sehen. Sie hätten jahrelang gelitten und würden nun den Spieß umdrehen. Die Frage ist also, wie als kränkend erfahrene Erlebnisse in der Schule psychisch so verarbeitet werden, dass ein Massaker als adäquate Lösungsmöglichkeit erscheint. Hierbei gilt es einerseits die psychischen Mechanismen paranoid-schizoider Art in den Blick zu bekommen, die diese Verarbeitung prägen, ohne zu einer manifesten psychischen Erkrankung zu führen, andererseits aber die gesellschaftlichen Vorbilder (Krieger und Soldaten in Ego-Shootern, Spielfilmen und Nachrichten), an die sich die Selbstbilder der School Shooter anlehnen, nicht zu vergessen. Die letztere Perspektive ergänzt die individualpsychologische Betrachtung und nimmt die Verbindung der Taten mit ihrem gesellschaftlichen Umfeld in den Blick.
In Zusammenarbeit mit der Ada und Theodor Lessing Volkshochschule Hannover und dem Institut für Soziologie der Leibniz Universität Hannover
Jour fixe im Oktober
Mi, 10.10.2012, 18 Uhr c.t.
Im Moore 21, Vorderhaus, Raum A210
Angela Moré (Hannover):
Gruppenanalyse und Demokratisierungsprozesse
Zur Geschichte und politischen Zielsetzung der Gruppenanalyse und Demokratisierungsprozesse bei Foulkes
Die Gruppenanalyse hat ihre Wurzeln nicht nur in der Psychoanalyse, sondern auch in den sozialphilosophischen und soziologisch-politischen Diskussionen der zwanziger und dreißiger Jahre. Der aus Karlsruhe stammende Psychiater Siegmund Heinrich Fuchs machte seine Lehranalyse bei Helene Deutsch in Wien und kehrte danach nach Frankfurt zurück, wo er Klinikleiter des neu gegründeten Instituts für Psychoanalyse wurde. Dieses befand sich im selben Gebäude wie das Institut für Soziologie. Hier begegnete er sowohl den Vertretern des Instituts für Sozialforschung (Horkheimer, Fromm, Marcuse, Löwenstein und Adorno) wie auch Norbert Elias und Kurt Lewin. Diese Einflüsse und Diskurse blieben für die weitere Entwicklung der Gruppenanalyse wesentlich, auch, nachdem Fuchs 1933 nach England emigriert war, wo er seinen Namen in Foulkes anglisierte.
Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Gruppenanalyse gehört die Einsicht, dass das Unbewusste immer ein kollektiv hergestelltes und geteiltes Unbewusstes ist. Auf dem Hintergrund der Erfahrung des Nationalsozialismus war für Foulkes die Gruppe nicht nur ein ‚Instrument’ der Heilung von psychischen Leiden, sondern auch der Entwicklung von Unabhängigkeit, Reife und Verantwortungsfähigkeit in demokratischen Strukturen.
Angela Moré ist Apl. Professorin für Sozialpsychologie an der Leibniz Universität Hannover, Dozentin und Studiengangsleiterin am Winnicott Institut und Gruppenanalytikerin.
Jour Fixe im September
Mi, 12.09.2012, 18Uhr c.t.
Im Moore 21, Vorderhaus, Raum A210
Gregor-Sönke Schneider (Hannover):
Keine Kritische Theorie ohne Leo Löwenthal.
Die Zeitschrift für Sozialforschung
Der Umfang und die Bedeutung der Arbeit von Leo Löwenthal am Institut für Sozialforschung ist im Unterschied zu den Beiträgen Horkheimers, Adornos, Marcuses, Fromms u.a. weitgehend unbeachtet oder vergessen geblieben. Doch Löwenthal trug ebenfalls maßgeblich zur Entwicklung der Kritischen Theorie bei – sowohl in theoretischer als auch praktischer Hinsicht: als verantwortlicher Schriftleiter der Zeitschrift für Sozialforschung, dem Forum und Sprachrohr des Instituts für Sozialforschung, aber auch mit seinen eigenen originären theoretischen Beiträgen, die in enger inhaltlicher Beziehung zu den Arbeiten der anderen Institutsmitglieder stehen. In dem Vortrag wird im Sinne einer Intellectual History der Beitrag von Leo Löwenthal an der Konzeption der Kritischen Theorie im Rahmen der Zeitschrift für Sozialforschung herausgestellt.
Gregor-S. Schneider (Hannover), Diplom-Sozialwissenschaftler, promovierte 2012 mit der Dissertation „Keine Kritische Theorie ohne Leo Löwenthal. Die Zeitschrift für Sozialforschung (1932-1941/42)“ an der Leibniz Universität Hannover.
Plakat zum Jour Fixe
Antisemitismus/Erfahrungen. Spätfolgen der Shoah und Antisemitismus heute
8. und 9. September 2012, Fachhochschule Frankfurt a. M. (Nibelungenplatz 1)
Samstag, 8. September
10:15 Lars Rensmann: Kollektiviertes Ressentiment und subjektive Erfahrung. Zur politischen Psychologie des Antisemitismus im deutschen und europäischen Kontext
11:45 Jan Lohl: “Die Deutschen wurden bestraft, die Juden nicht” Zur Konstitution des Antisemitismus nach Auschwitz im Alltagsdiskurs der 1950er Jahre
14:00 Katharina Rothe und Judith Lebiger-Vogel: Antisemitismus in Deutschland im Kontext der Abwehr von Schuld und Scham
15:00 Andrea Neugebauer: Die Reproduktion von Antisemitismus bei der interaktiven Herstellung von NS-Vergangenheit. Ko-Konstruktionen in den 1980er Jahren
16:30 Gruppenanalytischer Reflektionsraum (mit Angela Moré und Nele Reuleaux)
19:30 Film : Zur Darstellung, Rezeption und Verarbeitung antisemitischer Alltagserfahrungen im deutschen. Interaktive Rezeption eines Fernsehfilms (mit Michael Vollrath und Doreen Röseler)
Sonntag, 9. September
10:00 Kurt Grünberg: Ist das Antisemitismus? Deutsch-jüdische Erfahrungen nach der Shoah
11:00 Ruth Zeifert: “Vaterjuden” – Gibt es “positive” Antisemitismus-Erfahrungen?
12:20 Julia Bernstein und Lena Inowlocki: “Juden” als Fremde und Andere in Deutschland nach 1945: Verbindungen von Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus
13:20 Abschlussdiskussion
14:00 Ende der Tagung
Veranstalterin: Überregionale Forschungsgruppe am Sigmund-Freud-Institut zu den psychosozialen Spätfolgen der Shoah
Gefördert durch die Friedrich-Ebert-Stiftung
Weitere Infos finden Sie hier
Jour fixe im August
Mittwoch, 8. August 2012, 18Uhr c.t.
Im Moore 21, Vorderhaus, Raum A210
Olaf Kistenmacher (Hamburg):
Israel-Feindschaft in Deutschland. Eine Variante des Schuldabwehr-Antisemitismus?
Zur Erklärung der Feindschaft gegen den Staat Israel wird oft auf das Konzept des Schuldabwehr- oder das des sekundären Antisemitismus verwiesen, das die Kritische Theorie in den 1950/1960er Jahren entwickelte. Tatsächlich lassen sich mit diesem Konzept die Besonderheiten der Judenfeindschaft nach 1945 erfassen und auch aktuelle Beispiele der sogenannten „Israel-Kritik“ deuten. Der Vortrag wird sich mit einem Beispiel beschäftigen, bei dem Judenfeindschaft kaum vermutet wird: Der Antizionismus der KPD zur Zeit der Weimarer Republik, der mit spezifischen antikapitalistischen Vorstellungen verbunden war.
Olaf Kistenmacher promovierte 2011 an der Universität Bremen über antisemitische Aussagen in der Tageszeitung der KPD – Die Rote Fahne – während der Weimarer Republik. Er ist Mitglied des Villigster Forschungsforums zu Nationalsozialismus, Rassismus und Antisemitismus e.V.
Mit freundlicher Unterstützung durch die Amadeu Antonio Stiftung.
Plakat zum Jour fixe