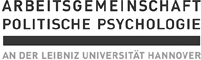Jour Fixe im Januar
Mi,18.01.2012, 18 Uhr c.t.
Im Moore 21, Vorderhaus, Raum A210
Wie weiter nach dem BA?
Master-Studiengänge mit kritisch-sozialwissenschaftlicher Ausrichtung
Mit Anna Gies (Soziologie, FfM), Jan Harig (Gender Studies, HU Berlin), Insa Kleimann (Gender Studies, Göttingen), Till Machnik (Politische Theorie, FfM; angefragt) und Marc Schwietring (Psychologie, IPU Berlin)
Kritisch ausgerichtete und insbesondere subjektorientierte Theorien und Ansätze haben es gegenwärtig schwer an den deutschen Hochschulen. Die Abwicklung der hannoverschen Sozialpsychologie und der Gender Studies ist dafür nur ein Beispiel. Während es vor der Umstellung auf die BA/MA-Struktur möglich war, ein sozialwissenschaftliches, „kritisches“ und teilweise interdisziplinäres „Komplettstudium“ in Hannover zu absolvieren, müssen nun die meisten BA-SoWi-Studierenden in anderen Städten nach Anschlussmöglichkeiten für ihre Studieninhalte suchen.
Da es nicht leicht ist, sich in der Vielfalt der bundesweiten, aber auch internationalen Master-Angebote zu orientieren, wollen wir in diesem Jour fixe einige MA-Studiengänge aus dem deutschsprachigen Raum vorstellen, aber auch sonstige Perspektiven diskutieren. Einige „Ex-HannoveranerInnen“ werden dabei aus eigener Erfahrung berichten und für Fragen zur Verfügung stehen. Dabei geht es zum einen um eine Vorstellung von Studiengängen, ihren Besonderheiten, Inhalten und Strukturen und zugleich um die Frage, wo in welchem Maße bzw. ob überhaupt an einem Ort an kritische Studienschwerpunkte der hannoverschen Sozialwissenschaften, speziell der Sozialpsychologie angeschlossen werden kann.
Der Jour Fixe soll BA-Studierenden Perspektiven vermitteln für eine Fortfüh-rung der bisher bewusst eingeschlagenen Studienwege. Darüber hinaus soll er dazu dienen, das wissenschaftliche „Feld“ danach zu überprüfen, wie es überhaupt um die Möglichkeit eines kritischen sozialwissenschaftlichen Studiums gestellt ist und welche „kleinen Inseln“ es gibt, auf denen gegenwärtig als überholt abgetane Theoriestränge (wieder) aufgenommen, reflektiert, weiterentwickelt werden.
Plakat zum Jour fixe
Buchvorstellung in Bremen
Mittwoch, 11. Januar 2012, 20 Uhr
Infoladen / St. Pauli-Str. 10-12 / 28203 Bremen
Volksgemeinschaft, Täterschaft, Antisemitismus. Beiträge zur psychoanalytischen Sozialpsychologie des Nationalsozialismus und seiner Nachwirkungen
Buchvorstellung und Diskussion mit Isabelle Hannemann, Prof. Rolf Pohl und Sebastian Winter
Was machte die Idee der Volksgemeinschaft und den Antisemitismus für die Menschen im Nationalsozialismus so attraktiv? Wie wurden sie zu Tätern und Täterinnen? Wie wirken sich NS-Gefühlserbschaften noch in den nachfolgenden Generationen aus? Der Nationalsozialismus und seine gesellschaftlichen Nachwirkungen sind ohne eine sozialpsychologische Perspektive nicht zu verstehen. Dies erfordert die Berücksichtigung der subjektiven Dimension der Nachkriegsgesellschaft sowie der Brüche und Kontinuitäten nach 1945.
Der Band versammelt Aufsätze, die sich aus einer psychoanalytisch-sozialpsychologischen und geschlechtertheoretischen Perspektive sowohl mit den psychodynamischen Mechanismen der nationalsozialistischen Weltanschauung und Gewalt als auch mit den Versuchen ihrer psychischen Verarbeitung in der Nachkriegszeit auseinandersetzen.
Eine Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Initiative – Die Rosa-Luxemburg-Stiftung in Bremen.
Jour fixe im Dezember
Mi,09.11.2011, 18 Uhr c.t.
Im Moore 21, Vorderhaus, Raum A210
Filmvorführung mit Diskussion:
Oi! Warning
Regie: Benjamin und Dominik Reding, D 2000
Janosch ist grad 17 geworden, von der Schule geflogen und haut von zuhause ab zu einem Bekannten im Ruhrpott, Koma. Dieser ist Skinhead, unpolitisch, wie er sagt, Janosch ist tief beeindruckt von dem kräftigen und rauhen Kerl. Auch Janosch rasiert sich seine Haare und taucht immer tiefer in die Skin-Szene ein. Die Leute respektieren und fürchten ihn, eine Mitschülerin verliebt sich in ihn, sie kommen sich näher. Aber Koma ist eifersüchtig über das „Fremdgehen“ seines Zöglings. Aus Wut verprügelt er einen Punk, Janosch hilft mit und im Rausch der ersten ausgeteilten Prügel und des ersten sexuellen Kontaktes macht er sich auf den Weg zu einem Tätowierer, der ihm einen Skinhead auf die Brust stechen soll. Dort lernt er den fröhlichen Punk und Feuerschlucker Zottel kennen, der ihn auch sehr fasziniert. Als Komas Häuschen explodiert, explodiert auch Koma: der verprügelte Punk sei schuld, und er schwört, diesen „platt zu machen“. Janosch wird das alles unheimlich, er distanziert sich immer mehr, besucht Zottel, freundet sich mit ihm an und zieht zu ihm auf den Bauwagenplatz. Sie kommen sich näher. Das kann der Skinhead Koma wiederum nicht auf sich sitzen lassen…
Der Film zeigt exemplarisch, wie xenophobe und gewaltaffine Lösungsversuche der männlichen Adoleszenzkrise in „die fatalen Sackgassen eines kollektiven Wahns“ führen können, „der sich in Hass und Zerstörung entlädt“ (Lexikon des Internationalen Films). So ist dies auch vor dem Hintergrund der aktuellen Rechtsextremismus-Diskussion ein sozialpsychologisch aufschlussreicher Film.
Plakat zum Jour fixe
Kindheit im Nationalsozialismus und Zweiten Weltkrieg – Trauma im Alter
Tagung am 24. März 2012
Veranstaltungsort: Evangelische Stadtakademie,
Römerberg 9, Frankfurt am Main
Die Problematik der deutschen „Kriegskinder“ des 2. Weltkriegs ist seit einigen Jahren in Forschung und Öffentlichkeit präsent. Die meisten Studien und Veranstaltungen konzentrieren sich hierbei vor allem auf Erlebnisse wie Vaterlosigkeit, Bombenangriffe sowie Flucht und Vertreibung und derenSpätfolgen, unter denen viele der zwischen 1930 und 1945 geborenen Personen leiden. Die Aufmerksamkeit, die dieses Thema im gesellschaftlichen Diskurs erfährt, wird kontrovers diskutiert: Auf der einen Seite wird die Notwendigkeit hervorgehoben, den leidvollen Erfahrungen dieser Kinder einen Raum zu geben; auf der anderen Seite wird die Betonung des Leidens auf deutscher Seite als Ausdruck von Schuldabwehr und Aufrechnung kritisiert. Diese politische Kontroverse verdeckt jedoch vielfach den Blick auf die spezifischen Sozialisationsbedingungen während des Nationalsozialismus. Die NS-Erziehung sowie die unbewusste Weitergabe unverarbeiteter Konflikte und Wertvorstellungen der Eltern haben vielfältige Spuren in den Lebensgeschichten und Erfahrungen dieser Generation hinterlassen. Die Prägungen dieser Generation und deren spezifische Traumatisierung können nur hinreichend verstanden werden, wenn die Bedrohung durch die Kriegsereignisse zusammen gedacht wird mit den Erfahrungen, welche die Kriegskinder mit ihren Eltern und anderen Bezugspersonen gemacht haben. Das Ziel der Veranstaltung besteht darin, diese Verbindung herzustellen, die im Kriegskinder-Diskurs gewöhnlich ausgeblendet wird, und die Kindheitserlebnisse aus dem Krieg entsprechend zu kontextualisieren. Die Veranstaltung wendet sich an ein interdisziplinäres Fachpublikum sowie eine interessierte Öffentlichkeit.
Mit Vorträgen von Jan Lohl, Ilka Quindeau und Peter Schulz-Hageleit.
Link zum Flyer der Tagung
Tagung „Das psychohistorische Erbe der Nazizeit – und seine Spuren in der Gegenwart“
20. – 22. Januar 2012
Evangelische Akademie Hofgeismar
Gesundbrunnen 8 – 11, 34369 Hofgeismar
Die sozialgeschichtlichen Folgewirkungen des Nationalsozialismus auf der Täterseite gehören zu den am besten gehüteten Geheimnissen der deutschen Nachkriegsgeschichte. Neuere Forschungen zeigen, dass die unbewusste Weitergabe unverarbeiteter Konflikte der Tätergeneration (NS-Gefühlserbschaften) ein Erklärungsfaktor für die Attraktivität rechtsextremer Orientierungsangebote darstellen kann. Dabei sind nationalistische und antisemitische Handlungsmuster nur eins von zahlreichen Phänomenen, die sich aus der Wirkung der von den Eltern und Großeltern übernommenen Gefühlserbschaft erklären lassen.
Die Tagung setzt die erinnerungspolitische Debatte um einen heilsamen Umgang mit unserer NS-Vergangenheit fort.
Mit Vorträgen und Workshops von Ute Althaus, Hannes Heer, Elke Horn, Jan Lohl und Angela Moré.
Programm der Tagung
Seite 15 von 24« Erste«...10...1314151617...20...»Letzte »