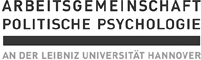Buchvorstellung in Frankfurt a.M.
Freitag, 04. Mai, 20h
Institut für vergleichende Irrelevanz (ivi), Kettenhofweg 130, Frankfurt a.M.
Volksgemeinschaft, Täterschaft, Antisemitismus.
Beiträge zur psychoanalytischen Sozialpsychologie des Nationalsozialismus und seiner Nachwirkungen
Buchvorstellung und Diskussion mit Markus Brunner, Jan Lohl, Rolf Pohl und Sebastian Winter
Was machte die Idee der Volksgemeinschaft und den Antisemitismus für die Menschen im Nationalsozialismus so attraktiv? Wie wurden sie zu Tätern und Täterinnen? Wie wirken sich NS-Gefühlserbschaften noch in den nachfolgenden Generationen aus? Der Nationalsozialismus und seine gesellschaftlichen Nachwirkungen sind ohne eine sozialpsychologische Perspektive nicht zu verstehen. Dies erfordert die Berücksichtigung der subjektiven Dimension der Nachkriegsgesellschaft sowie der Brüche und Kontinuitäten nach 1945.
Der Band versammelt Aufsätze, die sich aus einer psychoanalytisch-sozialpsychologischen und geschlechtertheoretischen Perspektive sowohl mit den psychodynamischen Mechanismen der nationalsozialistischen Weltanschauung und Gewalt als auch mit den Versuchen ihrer psychischen Verarbeitung in der Nachkriegszeit auseinandersetzen.
Rechtsstaatliche Demokratie und Erbschaft des Nationalsozialismus in der frühen Bundesrepublik
Symposium zum 70. Geburtstag von Prof. D. Joachim Perels
21. – 22. April 2012, Leibnizhaus Hannover
Veranstaltungsprogramm
Jour fixe Spezial im März
Mi,14.03.2012, 18 Uhr c.t.
Im Moore 21, Vorderhaus, Raum A210
Die Zukunft der Arbeitsgemeinschaft Politische Psychologie
Grundsatz- und Perspektivdiskussion
Die Arbeitsgemeinschaft Politische Psychologie wurde an der Leibniz Universität Hannover im Januar 2009 als Gegengewicht gegen die Schließung des Fachs Sozialpsychologie gegründet. Sie hat seitdem mehrere Tagungen durchgeführt, einige Sammelbände herausgegeben und in der Planung, eine eigene Homepage eingerichtet und vor allem monatliche Jours fixes zu unterschiedlichen Themen einer subjekt- und gesellschaftstheoretisch ausgerichteten politischen Psychologie organisiert. Außerdem ist sie gut vernetzt und personell nicht nur in Hannover, sondern auch an anderen Hochschulstandorten (Frankfurt, Berlin, Zürich, Wien) präsent. Aber reicht das aus und genügen diese Aktivitäten den mit der Gründung der AG verbundenen Ansprüchen?
Inzwischen haben sich die gravierenden strukturellen Veränderungen an der Universität (nicht nur in Hannover) verfestigt. Das hat Folgen für die hochschulpolitischen Interventionsmöglichkeiten der AG, die daher neu überdacht werden müssten. Gleichzeitig stellen bestimmte gesellschaftspolitische Entwicklungen neue Herausforderrungen für die Arbeit und vor allem das politische Selbstverständnis der AG dar (Wirtschaftskrise, Rechtsextremismus etc.). Außerdem sind mit dem Weggang einiger Gründungsmitglieder und Koordinatoren aus Hannover sowie der geringer gewordenen Teilnahme an den monatlichen Jours fixes einige innerorganisatorische Probleme hinzugetreten.
Vor diesem Hintergrund sind eine kritische Bilanzierung der bisherigen Arbeit der AG sowie eine grundsätzliche Diskussion ihrer aktuellen und zukünftigen Ausrichtung dringend notwendig geworden.
Im Einzelnen sollen daher folgende Punkte diskutiert werden:
• Politischer Anspruch und politisch-publizistische Interventionen
• Intensivierung von Theorie- und Konzeptdiskussionen
• Verbindung der Arbeit an den verschiedenen Hochschulstandorten
• organisationspraktische Fragen und Jour-fixe-Planungen
Da es um entscheidende Weichenstellungen hinsichtlich der Zukunft der gesamten AG geht, ist eine breite Beteiligung von Mitgliedern und InteressentInnen erwünscht.
Plakat zum Jour fixe Spezial
Jour Fixe im Februar
Mi,08.02.2012, 18 Uhr c.t.
Im Moore 21, Vorderhaus, Raum A210
Melanie Babenhauserheide (Universität Bielefeld):
Dudleys Luftgewehr und Harrys „Nimbus 2000“
Ideologiekritische Überlegungen zur zauberhaften Warenwelt in Rowlings Harry Potter-Reihe
„Die Empfindung, daß die eigenen Neigungen nicht voll erwidert werden, macht sich […] in der aus frühen Kinderjahren oft bewußt erinnerten Idee Luft, man sei ein Stiefkind oder ein angenommenes Kind.“ (Freud)
Bis Harry Potter erfährt, dass seine Eltern berühmte und begabte Magier waren und er selber eigentlich in dieser zauberhaften Parallelwelt zuhau-se ist, lebt er als Findelkind bei seiner Tante Petunia, seinem Onkel Ver-non und seinem Cousin Dudley Dursley. Dudley ist eine Figur, deren Ab-kunft vom Neid in jeder Zeile über den verfressenen Rabauken zu lesen ist. Sein Umgang mit seinen Besitztümern, die er nicht zu schätzen weiß, meistens entweder zerstört oder tauscht, reflektiert eine gesellschaftliche Realität: den Verfall des Gebrauchswerts.
Doch was die Kritische Theorie als gesamtgesellschaftliche Tendenz a-nalysiert, wird in der Harry Potter-Reihe personalisiert: Es ist eine Cha-rakterschwäche der Dursleys. Der bescheidene Harry, der die Dinge noch zu schätzen und zu nutzen weiß, ist allerdings nur scheinbar ein Gegenbild; vielmehr legitimiert er diese Verhältnisse über den Neid. In der für einen kurzen Augenblick nach blanker Wunscherfüllung duften-den Zauberwelt gibt es weiterhin unhinterfragt Geld, Waren, Armut. Die Sehnsucht nach einer besseren Welt und dem Ausbrechen aus dem spießigen Kleinbürgertum, die (kindlichen) Wünsche nach Befreiung aus der familiären Ohnmacht und die Phantasie, dass die Dinge einen ande-ren Sinn haben könnten als ihre instrumentelle Bestimmung ihnen zu-kommen lässt, werden weitgehend überführt in eine Verabsolutierung der Warenform.
Plakat zum Jour Fixe
Was symbolisieren Minarette in Deutschland? Das Sichtbarwerden des “Anderen” im urbanen Zusammenhang europäischer Stadtgesellschaften
Vortrag von Guido Follert und Mihri Oezdogan im Rahmen des Forschungskolloquiums “Stadt-gestalten. Soziale Praktiken und Konstruktionen des Urbanen”
Mo, 23.01., 18 Uhr
Raum B 108, Historisches Seminar, Im Moore 21, Hinterhaus
Mit den Mitteln der Lorenzerschen psychoanalytischen Symboltheorie und der Ideologiekritik möchten wir beleuchten, was die sozialpsychologische Dynamik der ubiquitären Konflikte um Moscheeneubauten hierzulande ausmacht. Als deutlichstes Symbol der Präsenz und Sichtbarkeit der Vielfalt in der Migrationsgesellschaft werden von den Stadteinwohnern unserer Gegenwart Moscheen mit Minaretten erfahren. Mit Lorenzer kann man annehmen, dass das durch den Bau von Moscheen veränderte Gesicht unserer Städte für die Bildung von “affektiv-verwurzelter städtischer Gemeinsamkeit” von grosser Relevanz ist bzw. sein könnte. Dennoch wird bei jedem Bauvorhaben leidenschaftlich über die Höhe des Minaretts gestritten. Es lässt sich fragen, ob das, was hier interveniert, Rangordnungskämpfe in einer rassifizierten Gesellschaft sind, die ideologisch nicht unerheblich von Muslimenfeindschaft durchzogen ist.
Plakat zum Kolloquium